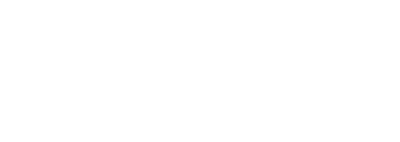Planung
Planung
Du möchtest ein MTB-Projekt in deiner Region starten? Dann lese zunächst:
Genehmigung
Genehmigung
Du hast Fragen wie deine konkreten Ideen genehmigt werden können? Dann starte mit:
Umsetzung
Umsetzung
Es kann losgehen, aber du benötigst Informationen zur Umsetzung? Dann bist du hier richtig.
Wir helfen
Wir helfen
Wie können wir mit dir zusammen arbeiten und dich unterstützen? Trete mit unserer Fachberatung in Kontakt.
Du möchtest einen Mountainbike-Trail, Flowtrail oder Dirtpark bauen?
Dann bist du bei uns richtig!
In unserem Trailbau-Leitfaden findest du praxisnahe Hilfestellungen rund um den Bau und die Genehmigung von MTB-Strecken und -Anlagen.
Auch wenn Mountainbiken größtenteils auf bestehenden Wegen stattfindet, können speziell angelegte Trails eine sinnvolle Ergänzung des Wegenetzes darstellen – etwa zur Lenkung, Entzerrung oder zur gezielten Förderung des Sports.
Unser Toolkit zeigt dir Schritt für Schritt, wie du Mountainbike-Trails nachhaltig planst, genehmigst und umsetzt – mit vielen Tipps aus der Praxis und einem klaren Fokus auf Umweltverträglichkeit.
Wer noch tiefer einsteigen möchte:
Die DIMB bietet eine Trailbau-Ausbildung – ideal für alle, die ihr Wissen erweitern und in die Umsetzung gehen wollen.
Jetzt Leitfaden lesen – und loslegen mit dem Trailprojekt!

Die einzelnen Schritte im Detail erklärt:
Art des Projektes
Mountainbike-Trails:
Als Mountainbike-Trails werden ganz allgemein bereits vorhandene oder eigens gebaute Wege bezeichnet, die für das Mountainbiken gerne genutzt werden. Diese Trails können unterschiedliche Schwierigkeitsgrade haben und variieren in ihrem Untergrund, der Streckenführung und den Hindernissen.

Flowtrail Stromberg
Es lassen sich diese Arten von Mountainbike-Trails unterscheiden:
- Singletrail – Ein schmaler, meist natürlicher Pfad, oft mit Wurzeln, Steinen und technischen Passagen. Der Begriff wird nicht nur für eigens gebaute, sondern auch für bereits vorhandene Wege verwendet.
- Flowtrail – Eine leicht rollbare Strecke mit Kurven, kleinen Sprüngen und Wellen, die für ein flüssiges Fahrerlebnis sorgen.
- Freeride-Trail – Eine Strecke mit künstlichen und natürlichen Hindernissen wie Drops, Sprüngen und Northshore-Elementen (Holzbrücken).
- Enduro-Trail – Eine Mischung aus Auf- und Abfahrten, oft in Etappen gefahren.
- Downhill-Trail – Eine steile Abfahrt mit technischen Hindernissen, Sprüngen und hohen Geschwindigkeiten. Diese finden sich überwiegend in kommerziellen Bikeparks mit Liftbetrieb, da für die schweren Fahrräder eine Aufstiegshilfe benötigt wird.
- Trailpark – Wo mehrere Trails aneinander gereiht werden, entsteht ein Trailpark. Die Vorbilder sind die 7 Stanes in Schottland und Singltrek Pod Smrkem in Tschechien. Der Trailground Brilon und die Heumöderntrails bei Treuchtlingen sind die ersten kleineren Trailparks, die in Deutschland bereits entstanden sind. Mit den Green Trails in Waldeck-Frankenberg befindet sich derzeit größeres Projekt in Bau.
Bei Mountainbike-Trails ist die Nutzung kostenfrei im Rahmen des Betretungsrechtes. Die Genehmigung kann daher analog der Genehmigung von Waldwegen erfolgen, denn der umgebende Wald kann weiterhin bewirtschaftet werden. Mountainbike Trails gelten, vergleichbar wie Trimm-Dich-Pfade oder Klettersteige, nicht als Sportanlagen. Siehe dazu auch unseren Artikel „Waldweg oder Sportanlage“.
Mountainbike-Anlagen
Eine Mountainbike-Anlage befindet sich auf einer abgegrenzten und ausschließlich dafür bereit gestellten Fläche. Darunter fallen beispielsweise:
- Pumptracks: Ein Pumptrack ist eine geschlossene Rundkurs-Strecke, auf der man ohne Treten fahren kann. Der Fahrer erzeugt Schwung, indem er seinen Ober- und Unterkörper pumpt.
- Dirtparks: Anlage mit verschiedenen hohen Hügeln und Sprungelementen aus Erde und Holz.
- BMX Anlagen: Wellenbahn mit Hindernissen für BMX Wettkämpfe.
Die Genehmigung erfolgt in der Regel als Sportanlage. Die Anlage wird zumeist von einem lokalen Verein oder der Gemeinde betrieben und sind ein wichtiger Treffpunkt, der vor allem jüngere MountainbikerInnen anspricht. Pumptracks sind sogar mit dem normalen Rad oder Tretrollern befahrbar und sorgen für einen ersten Kontakt mit dem Thema Mountainbike. Sie schulen das Gleichgewicht und die Radbeherrschung und sollten an vielen Stellen entstehen, wo Kinder und Jugendliche ihre Freizeit verbringen.
Betreiber & Verein
Ein Mountainbike-Trail oder eine -Anlage benötigt einen Verantwortlichen, der für die Errichtung und Unterhaltung zuständig ist. Dies kann – bei nicht gewerblich betriebenen Strecken – die Gemeinde, einen DIMB IG oder ein Verein sein. Aktuell werden viele nichtkommerzielle Strecken durch Vereine betrieben, die damit auch Aufgaben wie z.B. Finanzierung, Kontrolle, Versicherung und Unterhalt zu organisieren und zu tragen haben.
Eine einfachere Möglichkeit, als ein eigener Verein, ist die Gründung einer DIMB IG. Eine DIMB IG ist eine Ortsgruppe der DIMB e.V.. Das bedeutet, dass viel von der Vereinsorganisation von der DIMB als Hauptverein abgenommen wird. Sprecht uns dazu an, welche Möglichkeiten eine DIMB IG bietet.
Da es sich bei den Strecken in der Regel um öffentliche Angebote handelt, die allen Nutzern offen stehen, wäre es aus Sicht der DIMB wünschenswert, wenn sich mehr Gemeinden für den Betrieb verantwortlich zeichnen würden. Vergleichbar wie Gemeinden auch Wanderwege, Spielplätze und Freizeitanlagen für ihre Bürger in ihrer Verantwortung haben.
Für Gemeinden besteht zudem die Möglichkeit, die Strecke in ihrer erweiterten Gemeindehaftpflicht, meist kostengünstiger als ein Verein das kann, mit zu versichern. Die regelmäßige Kontrolle der Strecke wiederum kann der betreuende Verein als Trailpate übernehmen.
Eine DIMB IG oder ein Verein ist daher aus den vorgenannten Gründen in den meisten Fällen als Betreiber oder Betreuer sinnvoll. Daher sollten vorher Überlegungen zu einem möglichen Vereinsbeitritt oder gar einer Vereinsgründung angestellt werden.
Vorteile DIMB IG
- Organisationsstrukturen der DIMB können genutzt werden
- Lediglich Wahl von IG Sprechern und Benennung eines Streckenverantwortlichen notwendig
- Umfangreiches Know-How der DIMB Fachberatung bei Genehmigungsfragen
- Versicherung der Strecke über DIMB e.V.
Nachteile DIMB IG
- Eine DIMB IG ist rechtlich nicht selbständig
- Wichtige Entscheidungen müssen mit der DIMB e.V. abgestimmt werden
Vereinsgründung oder Anschluß an örtlichen bestehenden Verein?
Es besteht auch die Möglichkeit, selbst einen Verein zu gründen. Dies kann im Vergleich zum Anschluss an einen bereits bestehenden Verein folgende Vor- und Nachteile bieten:
Vorteile eigener Verein
- Unabhängigkeit von alten Strukturen
- Keine Verpflichtungen zur Mithilfe in anderen Vereinsaktivitäten. Denn die Streckenpflege ist schon so intensiv, dass weitere Verpflichtungen zur Überforderung führen können.
- Finanzielle Unabhängigkeit. Selbst erzielte Einnahmen der Bikesparte können nicht für andere Zwecke, die nichts mit der Strecke zu tun haben, verwendet werden.
- Keine evtl. Bevormundung durch Laien, die keine Kenntnisse vom Bikesport / dem Streckenbau besitzen.
Nachteile eigener Verein
- Organisationsstrukturen müssen erst aufgebaut werden
- Keine Unterstützung aus anderen Sparten etc.
- Keine Nutzung bestehender Kontakte & Netzwerke
- Etwas geringere Akzeptanz als ein alteingesessener örtlicher Verein
- Keine Nutzung von vorhandenem organisatorischen Knowhow
- Erheblicher Zusatzaufwand für Gründung und Führung eines Vereins
- Sieben Volljährige Gründungsmitglieder erforderlich
DIMB Merkblatt zur Vereinsgründung
Weitere Informationen und Unterstützung zur Vereinsgründung gibt es auch beim jeweiligen Landessportbund.
Wer macht und wer bezahlt?
Interessierte müssen sich darüber bewusst sein, dass trotz der möglichen Unterstützung durch Gemeinden, Vereine etc. die Einrichtung und auch der Unterhalt eines solchen Projektes viel Zeit, Mühe und auch Geld kostet. Ist der Bau der Strecke erst einmal abgeschlossen, wird häufig bewusst, dass der Aufwand für die anschließende Instandhaltung der Strecke unterschätzt wurde und so manches genehmigte und realisierte Projekt schläft still und leise wieder ein. Zudem ist der meist erforderliche Rückbau bei Beendigung der Nutzung zu bedenken.
Wer sich also zur Realisierung einer legalen Strecke entschließt, sollte vorher genau prüfen ob der persönliche Background überhaupt geeignet ist.
Es ist hilfreich, sich vorab folgende Fragen realistisch zu beantworten:
A) Wie viele Personen haben Interesse an einer legalen Strecke?
Je größer die Anzahl der Personen, die die Strecke nutzen wollen, umso besser ist gegenüber den Verhandlungspartnern der Bedarf zu begründen. Eine Umfrage in Bikeshops, Internetforen (z.B. www.mtb-news.de), Schulen, Vereinen etc. kann hier sehr hilfreich sein und Leute zum Mitmachen motivieren.
B) Wie viele wollen tatsächlich bei der Realisierung mithelfen?
Mindestens genau so wichtig wie die Zahl der potenziellen Nutzer ist ein Team, das die Planung und Realisierung gemeinsam schultert. Ist die Zahl der „Macher“ zu gering entsteht sonst schnell die Gefahr der Frustration und das Projekt wird nicht mehr vorangetrieben.
C) Werden minderjährige Helfer ggf. durch ihre Eltern unterstützt?
Alle minderjährigen Helfer sollten im Vorfeld klären, ob die Erziehungsberechtigten mit einer derartigen Freizeitbeschäftigung einverstanden sind. Dies ist den verantwortlichen Machern gegenüber ggf. auch schriftlich zu erklären.
D) Sind Volljährige dabei, die bereit sind, Anträge etc. verantwortlich zu unterschreiben?
Zwei bis drei Personen sollten für das Projekt verantwortlich zeichnen und als Ansprechpartner für alle Beteiligten zur Verfügung stehen und ggf. auch zu einer Wahl in einen Vereinsvorstand bereit sein. Davon sollte mindestens eine Person volljährig sein, damit Verträge unterzeichnet werden können und um größere Akzeptanz bei den Verhandlungspartnern zu gewinnen.
In vielen Fällen ist es sinnvoll, einen rechtsfähigen Verein zu gründen bzw. sich einem solchen anzuschließen, der vor allem als Ansprechpartner für Behörden wirken kann.
E) Wie viel Zeit steht zur Verfügung?
Für den Vorbereitungsaufwand muss in Betracht gezogen werden, dass Berufstätige für Behördenbesuche, behördliche Streckentermine etc. in der Regel einige Tage Urlaub nehmen müssen. Für den wesentlich beliebteren Streckenbau können in der Errichtungszeit bis zu 5 Stunden täglich veranschlagt werden.
F) Soll das Projekt touristisch vermarktet werden?
Eine Kooperation mit dem Tourismus kann sinnvoll sein, denn der Tourismus hat oftmals einen guten Zugang zu den verschiedensten Belangträgern und hat Erfahrung in der Beantragung von Fördergeldern. Auch kann der Tourismus selbst als Verantwortlicher des Projektes dienen.
Dem gegenüber stehen oftmals Bedenken der örtlichen Belangträger, dass ein mehr an Mountainbikegästen nicht gewünscht wird, sondern die Genehmigung nur erteilt wird, wenn das Projekt überwiegend von den Einheimischen genutzt wird. Auch kann eine sehr hohe Frequentierung dazu führen, dass der Pflegeaufwand der Strecke aufwändig wird. Es ist daher nach den örtlichen Gegebenheiten abzuwägen, welche Zielgruppe mit dem Projekt angesprochen werden soll und in wie weit eine touristische Vermarktung für beide Seiten ein Gewinn ist.
G) Wie viel Geld steht für Nutzungsüberlassung, Baumaterial und ggf. Versicherung sicher zur Verfügung? Gibt es mögliche Spender von Material und / oder Geld?
Für die Nutzungsüberlassung, Baumaterial und ggf. Versicherung können selbst bei ehrenamtlichen Bauaktivitäten sehr schnell über 1000 Euro pro Jahr anfallen (abhängig von Streckenlänge und baulicher Beschaffenheit). Bei Trails auf den Grundstücken von Gemeinden oder Staatsforsten sollte aber keine oder nur eine symbolische Nutzungsüberlassungsgebühr vereinbart werden. Denn hier ergibt sich bereits aus dem Ziel der Förderung der Erholung der Auftrag an die öffentlichen Träger entsprechende Infrastruktur zu fördern.
Müssen Maschinen gemietet oder Arbeiten durch eine Firma ausgeführt werden, steigen die Kosten deutlich. Günstig ist, sich frühzeitig um „Sponsoren“ zu kümmern. Dies können Geldgeber oder Materialspender aus der Familie oder lokale Unternehmer sein. Für Dirtlines z.B. hat schon mancher Bauunternehmer (nicht schadstoffbelasteten und behördlich genehmigten!) Erdaushub kostenfrei zur Verfügung gestellt. Fragen kostet nichts. „Richtige“ Sponsoren können ebenfalls zur Finanzierung beitragen. Insbesondere solche, die am Biken oder der Entwicklung der Region ein Interesse haben. Neben Fahrradgeschäften können dies auch Betriebe aus der Gastronomie sein. Sparkassen, Banken oder Energieversorger haben Wettbewerbe und Förderprogramme, bei welchen man sich um Unterstützung bewerben kann. Ebenfalls erfolgversprechend sind Firmen, die zwar branchenfremd sind, aber der Inhaber ein leidenschaftlicher Mountainbiker ist.
Auch eine Nachfrage bei der Gemeinde ist sinnvoll, inwieweit hier evtl. Fördergelder aus Naturpark-, Landes-, Bundes- oder EU-Mitteln zur Verfügung stehen. Aber Vorsicht – Fördermittel sind nicht selten an einen langfristigen Betrieb gebunden (bis zu 20 Jahre). Also genau informieren!
H) Nutzungsgebühren
Die DIMB Politik ist, dass neue Projekte möglichst für alle Mountainbiker frei nutzbar sind, um den Sport zu fördern. Insbesondere bei Mountainbike-Trails in Wald und Natur lehnen wir Nutzungsgebühren ab. Diese stehen auch dem gesetzlich garantierten, kostenfreien Betretungsrecht entgegen. Die Erhebung von Nutzungsgebühren ist damit nicht vereinbar und Nutzer, die nicht bezahlen, können in der Praxis auch nicht an der Nutzung gehindert werden. Auch kann eine Nutzungsgebühr dazu führen, dass formell mit dem Nutzer ein Vertragsverhältnis eingegangen wird, aus welchem sich erhöhte Sorgfaltspflichten für den Streckenbetreiber ergeben können. Zu empfehlen ist aber die Möglichkeit, eine freiwillige Spende anzubieten. Ob als Spendenkasse vor Ort oder in moderner Form über einen QR Code zur Zahlung per Smartphone.
Urteil zur Unentgeldlichkeit des Waldbetretungsrechtes
Bay. Bekanntmachung zu Gebühren auf Langlaufloipen.
Urteil zum Tourengehen auf Skipisten.
I) Kann oder muss das Projekt einem Dritten zur Realisierung übertragen werden?
Evtl. hat auch der Grundstückseigentümer oder die Gemeinde ein eigenes gesteigertes Interesse daran, eine solches Projekt auszuführen und übernähme damit selbst einen ganz wesentlichen Teil der Planung. Ab einer bestimmten Projektgröße kann es auch notwendig werden, ein professionelles Planungsbüro einzubinden. Hierzu bedarf es aber erheblicher finanzieller Unterstützung (öffentliche Gelder, Sponsoren etc.).
Unterstützer suchen
Bei Mountainbike-Trails kann es ausreichen die ersten Gespräche im kleinen Kreis mit dem Revierleiter zu halten. Bei größeren Mountainbike-Anlagen kann es vorteilhaft sein, sich beim Jugendamt / Jugendzentrum oder Sportamt zunächst „Verbündete“ zu suchen, die sich im Behördendickicht etwas besser auskennen und vielleicht weitere Kontakte haben. Bei kleinen Gemeinden sollte man direkt an den Bürgermeister herantreten, wenn z.B. kein Jugendamt vorhanden ist. Außerdem ist es meist hilfreich, mit den vor Ort agierenden politischen Parteien zu sprechen. Es ist auch möglich die zuständigen Politiker zu Ortstermin an einer Vorbild-Strecke einzuladen, damit diese sich ein besseres Bild machen können.
Auch lokale Sponsoren können evtl. ihren Einfluss geltend machen. Nicht selten unterstützen auch die Touristikverbände alle Projekte, die Gäste in die Region bringen. Hier muss aber genau überlegt werden, ob die Strecke und auch die soziale Umgebung einen Mountainbike-Tourismus „vertragen“.
Überblick verschaffen
Es ist hilfreich, sich vor Kontaktaufnahme mit den Genehmigungsinstitutionen bei Experten für Natur und Umwelt sachkundig zu machen, um in Gesprächen mit Eigentümern mögliche Bedenken ausräumen zu können oder zumindest zu zeigen, dass man nicht ahnungslos ist und sich bereits schlau gemacht. Solche Auskünfte geben euch ggf. Fachleute in den Ortsgruppen des BUND (Bund Naturschutz Deutschland) oder des NABU (Naturschutz-Bund Deutschland). Es kann allerdings auch passieren, dass die Gesprächspartner dem Biken generell nicht unbedingt positiv gesonnen sind.
Vorurteile abbauen / Interesse wecken
Die wenigsten Grundstückseigentümer oder Verwaltungsmitarbeiter kennen sich mit Mountainbike-Projekten aus und sind manchmal durch negative Medienberichte bereits mit Vorurteilen belastet, die zunächst entkräftet werden müssen. Daher ist es wichtig, zuerst die Angst vor dem Unbekannten, dem Mountainbiken, zu nehmen und vor allem dessen positive Seiten verständlich zu erklären. Argumente für den Mountainbiken sind die Erholung durch die sportliche Betätigung, die sinnvolle Freizeitbeschäftigung an frischer Luft, Förderung von sozialen Kompetenzen durch das Teamwork etc..
Tipps!
- Erstellt eine erklärende Präsentation oder schriftliche Unterlagen
- Geht davon aus, dass Ihr Fachbegriffe wie Northshore, Drop usw. erstmal erklären müsst, da die Euren Gesprächspartner meist nicht bekannt sein werden.
Nachdem allgemein ein Bild vom Mountainbiken verschafft wurde, sollte anschließend das Vorhaben genauer erklärt werden. Es ist besser, einmal zu genau zu erklären, als Dinge im Unklaren und damit der Phantasie des Gesprächspartners zu überlassen. Wer nicht exakt sagt, was er eigentlich will, darf sich nicht wundern, wenn die „andere Seite“ möglicherweise negativ oder umständlich reagiert. Wenn Strecken beispielsweise deswegen abgelehnt worden sind, weil sie nicht in das Landschaftsbild passen, dann kann das auch daran gelegen haben, dass die Antragsteller sich vorher nicht um Landschaftsverträglichkeit bemüht oder die Darstellung dieser Aspekte schlichtweg vernachlässigt haben. Achtet bei der Auswahl von Beispielbildern darauf, wie diese auf andere wirken können. Vermeidet Bilder mit Action-Szenen oder erheblichen Baumaßnahmen in der Natur.
Standort
Planungsaufwand und Grundvoraussetzungen
Die verschiedenen Streckenarten sind mit unterschiedlichem Aufwand plan- und realisierbar und erfordern bestimmte Grundvoraussetzungen. Sinnvoll ist, sich bereits im Vorfeld mit vorhandenen Strecken zu beschäftigen. Für einen Mountainbike-Trail kann man sich beispielsweise die Eckdaten verschiedener Bikeparks von deren Homepage herunterladen und sich auch vor Ort Anregungen und Beispiele holen. Es macht in jedem Fall Sinn, Kontakt zu anderen Streckenbetreibern aufzunehmen und sich dort zu informieren.
Logistische Anforderungen an die Strecke
Zufahrtsmöglichkeiten sind von Anfang an wichtig, sowohl, was die Erreichbarkeit der Strecke angeht, als auch für die interne Logistik. So müssen beispielsweise Baumaterialien möglichst nahe und ohne große Schlepperei an die Strecke gebracht werden können. Gute Zufahrtswege erleichtern außerdem im Falle eines Unfalls den Rettungsdiensten eine problemlose und schnelle Versorgung des Verletzten. Kilometerlange Laufwege für die Rettungskräfte sind da eher von Nachteil. Ideal ist es in dem Zusammenhang auch, wenn möglichst von allen Stellen der Strecke Handy-Empfang besteht, um im Notfall rasch den Rettungsdienst oder andere Hilfe herbeirufen zu können. Dabei reicht der Handy-Empfang in einem einzigen Netz, um den Notruf 112 absetzen zu können.
Ebenso ist die problemlose Rückführung zum Start wichtig. Die beste Lösung für die Natur ist sicherlich die Bewältigung der Bergaufstrecke zum Start mit Muskelkraft. Die Auffahrt sollte dann entweder vergleichsweise flach und damit auch mit dem schweren Freeride-Bike fahrbar, oder aber kurz und steil, zum schnellen Durchschieben geeignet sein. Eher selten, sind vorhandene Auffahrhilfen, wie zur Benutzung freigegebene Liftanlagen.
Das Fahren durch den Wald mit Kfz sollte möglichst vermieden werden. Ist bei Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen das Befahren der Waldwege als nichtöffentlicher Verkehrsraum mit dem Kfz unvermeidbar, ist hier ggf. eine Genehmigung durch das Forstamt und die betroffenen Grundeigentümer erforderlich.
Je nach zu erwartendem Besucherverkehr sollte auch an Parkplätze und eine Lenkung des PKW Verkehrs gedacht werden. Ideal ist, wenn die Strecke mit dem öffentlichen Nahverkehr erreicht werden kann, so weit dort eine Fahrradmitnahme möglich ist.
Spätestens, wenn die Strecke einmal für Rennen oder ähnliches genutzt werden soll, ist es von Vorteil, Möglichkeiten für Anschlüsse an Strom, Wasser und Abwasser eingeplant zu haben. Ideal ist natürlich, wenn Infrastruktur vorhanden ist (benachbartes Sportgelände etc.).
Eigentümergestattung
Der Eigentümer des Grundstücks muss die Nutzung genehmigen. Eigentümer kann das Land, die Gemeinde oder eine Privatperson sein. Bei der Grundstückswahl ist immer ein gewisses Maß an Flexibilität erforderlich, denn nicht selten werden vorgeschlagene Grundstücke zunächst abgelehnt.
In der Vorgehensweise zur Einholung der Genehmigung bestehen Unterschiede zwischen Grundstücken in Gemeinde-, Staats- oder Privatbesitz, die hier erläutert werden:
Privates Eigentum in öffentlicher Hand („öffentlicher Grund“)
Wenn das gewünschte Grundstück einer Stadt / Gemeinde gehört bzw. im Landesbesitz ist, sollte der Eigentümer von den Vorteilen zur Einrichtung eine Mountainbike Projektes überzeugt werden. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz gehört es auch zu den Aufgaben der öffentlichen Hand geeignete Grundtücke zur Erholung zur Verfügung zu stellen. Will der Eigentümer die Strecke nicht selbst betreiben, kann er die Nutzung und die damit verbundenen Pflichten an einen Verein etc. mit einem Nutzungsvertrag übertragen (siehe auch Ausführungen unter „Betreiber & Verein“).
Ein geeignetes Gelände kann bereits vor dem ersten Gespräch ausgesucht und dem Eigentümer vorgeschlagen werden. Falls diese Geländeauswahl abgelehnt wird, sollte nach verfügbaren alternativen Grundstücken gefragt werden, die dann auf ihre Tauglichkeit geprüft werden müssen. Dabei kommt es oftmals zu mehreren Begehungen mit der unteren Forst- oder Naturschutzbehörde.
Privatgrund
Die Strecke auf Privatgrund zu errichten, ist in der Regel schwer möglich, da eine Privatperson meist Einnahmen erzielen möchte. Es sei denn, es bestehen persönliche Beziehungen zu einem Eigentümer.
Besonderheiten bei Gebühren für die Gestattung einer Strecke im Wald
Gebühren für die Gestattung für Mountainbike-Trails steht die DIMB kritisch gegenüber. Bei öffentlichem Grund sollte die Gestattung kostenfrei sein oder nicht über einen symbolischen Betrag hinaus gehen. Denn Mountainbike-Strecken gehören unseres Erachtens zur Daseinsvorsorge, so wie andere öffentliche Einrichtungen. Zudem finanzieren viele Vereine schon den Bau und Unterhalt der Strecke in Eigenleistung.
Auch wenn Gebühren für die Gestattung an den betreuenden Verein denkbar sind, so geht dies aber oftmals mit einer vollständigen Übertragung der Verkehrssicherungspflichten für das streckenumgebende Gelände bis hin zur Forderung einer professionellen Totholzbeseitigung einher, die ein Vereinsbudget schnell sprengen kann (ausgebildeter Gutachter, Maschineneinsatz etc.). Daher Augen auf bei den vertraglichen Formulierungen, welche Regelungen sinnvoll und überhaupt notwendig sind. Zu empfehlen ist, wenn die Verkehrssicherungspflichten für den umgebenden Wald beim Grundeigentümer verbleiben.
Die DIMB bietet auf Anfrage Musterverträge für ihre Mitglieder an. Darüber hinaus empfiehlt sich, jegliche Art von Vertrag oder Vereinbarung durch eine rechtskundige Person prüfen zu lassen.
Weiterführende Dokumente
- AID Infodienst. Verkehrssicherungspflicht für Waldbesitzer (Musterverträge am Ende)
- MTB Handbuch BW (Musterverträge am Ende)
Naturschutz
Unabhängig von der Art der Nutzung sind verschiedene naturschutzrechtliche Vorgaben zu beachten. Erholungsnutzung und Naturschutz sind dabei kein Widerspruch. So ist in § 1 Abs. 4 Nr. 3 des Bundesnaturschutzgesetzes geregelt, dass die Zugänglichmachung der Natur zu Erholungszwecken ein Ziel des Naturschutzes ist. Nach den Begriffsbestimmungen des § 7 Abs. 3 Nr. 3 Bundesnaturschutzgesetzes zählt zur Erholung die „natur- und landschaftsverträgliche sportliche Betätigung in der freien Landschaft“. Und nach § 14 des Bundeswaldgesetzes ist das Radfahren auf Wegen grundsätzlich erlaubt. Weitere Grundlagen können u.a. sein.
| Gesetze | Verordnungen usw. |
|
|
Diese Rechtsnormen dienen dazu, die Landschaft und den Wald mit seiner Flora und Fauna zu schützen. Die Nutzungseinschränkungen sind in den Bundesländern unterschiedlich geregelt und können daher in diesem Leitfaden nicht im Detail dargestellt werden.
Die Bundesländer haben online Kartendienste, in welchen die verschiedenen Schutzgebietskategorien abrufbar sind. Oft ist die zugehörige Verordnung, in welcher der Schutzzweck und die zulässigen Handlungen beschrieben sind, mit verlinkt. Bei der Planung möglichst zu vermeiden sind Nationalparke, Naturschutzgebiete, Biosphärenkerngebiete und geschützte Biotope, da diese die strengsten Schutzgebietsklassen sind.
In FFH- und Vogelschutzgebieten können neue Strecken genehmigt werden, erfordern aber eine FFH-Vorprüfung. Es gilt hier die zugehörigen Managementpläne zu lesen, was in dem FFH-Gebiet der konkrete Schutzzweck ist. Dieser Schutzzweck kann sich je nach FFH-Gebiet erheblich unterscheiden, so dass pauschale Aussagen nicht möglich sind. In vielen uns bekannten Fällen wurden MTB-Strecken in FFH-Gebieten genehmigt, da sie keinen erhebliche Beeinträchtigung für das Gebiet dargestellt haben, sondern durch ihre Lenkungswirkung zu einer Verbesserung der Gesamtsituation beigetragen haben. Auch im Leitfaden Natura 2000: Sport und Tourismus wird die Genehmigung von MTB-Strecken als sinnvolles Vorhaben zur Besucherlenkung erwähnt.
Landschaftsschutzgebiete, Naturparke oder Biosphärenrandgebiete sollten für Mountainbike-Trails kein Hinderungsgrund sein. Oftmals findet sich in diesen Schutzgebietsverordnungen auch die Zielsetzung die Erholungsnutzung für die Bevölkerung aktiv zu fördern. Es ist daher ratsam, bereits in der Vorplanung die Schutzgebiete zu berücksichtigen und somit gut vorbereitet in die Gespräche mit den Behörden zu gehen.
Eine naturschutz oder forstrechtliche Kompensation oder Ausgleichregelung für einen Mountainbike-Trail sollte in der Regel nicht notwendig sein. Denn vergleichbare Regelungen zum Forst- oder Freizeitwegebau sehen bei solchen Vorhaben keinen erheblichen Eingriff in die Natur. Auch ein landschaftsplanerischer Fachbeitrag ist dann nicht notwendig.
Umweltkartendienste z.B:
Artenschutz:
Neben den geschützten Flächen können in dem Gebiet auch geschützte Arten vorkommen. Auch diese müssen dann bei der Planung berücksichtigt werden. Wir beobachten, dass hier vermehrt aufwändige artenschutzrechtliche Gutachten eingefordert werden. Diese sind aber nur dann notwendig, wenn in dem Zielgebiet geschützte Arten vorkommen und davon auszugehen ist, dass diese in ihrer Population nachhaltig beeinträchtigt werden. Sollten Gutachten gefordert werden, dann wären zunächst die Umweltämter anzufragen, ob nicht bereits Kartierungen von geschützten Arten vorliegen.
Bei einer weitgehend naturbelassenen Strecke ist auch anzunehmen, dass diese kaum erhebliche Störungen während des Betriebes verursacht. Die etwas störintensiveren Baumaßnahmen lassen sich leicht in störungsunempfindlichere Zeiträume verlegen. Bevor ein artenschutzrechtliches Gutachten in Auftrag gegeben wird, empfehlen wir daher den Kontakt mit der DIMB-Fachberatung aufzunehmen.
Genehmigungsverfahren
Je nach Vorhaben kann sich der Genehmigungsprozess deutlich unterscheiden. Mountainbike Trails gelten, vergleichbar wie Trimm-Dich-Pfade oder Klettersteige, nicht als Sportanlagen, sondern sind dem Grunde nach nichts anderes sind als Wege im Wald. Das Genehmigungsverfahren entspricht daher dem für Wanderwege, wie viele erfolgreiche Beispiele seit Jahren belegen. Leider ist aber manchmal zu beobachten, dass nur deshalb, weil ein Weg mit einem MTB genutzt werden soll, die Behörden annehmen, dass es eine Waldumwandlung oder eine Änderung der Flächennutzung benötigt wird. Diese aufwändigen Verfahren sind aber nur dann notwendig, wenn der Wald seine Funktion für die Forstwirtschaft oder als Lebensraum nicht mehr erfüllen kann. Beispielsweise weil auf der Fläche viele parallele Fahrspuren und künstliche Einbauten errichtet werden. Siehe dazu auch den Artikel „Waldweg oder Sportanlage„.
Im einfachsten Fall, wenn keine Schutzgebiete betroffen sind, kann es sogar ausreichen, mit dem zuständigen Forstrevierleiter eine Absprache zu treffen, dass ein Weg in geringem Umfang für Mountainbiker modelliert werden darf. Insbesondere wenn die Strecke auf einer alten, bereits vorhandenen Wegetrasse verläuft und keine künstlichen Einbauten vorgesehen sind. Für größere Vorhaben wird aber ein Genehmigungsverfahren notwendig sein.
Wichtig ist sich an dieser Stelle zu verdeutlichen, dass es eigentlich nur zwei Voraussetzungen benötigt. Das Einverständnis des Grundeigentümer und die behördliche Genehmigung. Gerade bei kleineren Vorhaben raten wird dazu, zunächst das Gespräch auf diese Ansprechpartner zu begrenzen und im kleinen Rahmen die Möglichkeiten zu besprechen, wie mit möglichst wenig Aufwand das Projekt umgesetzt werden könnte.
Ist eine Einigung mit dem Grundeigentümer erzielt, wird im nächsten Schritt die Behörde angefragt. Je nach Bundesland ist die untere Forst- oder die untere Naturschutzbehörde der erste Ansprechpartner. Im günstigsten Fall übernimmt diese Behörden dann die Federführung und beteiligt weitere betroffen Behörden. Der Antragsteller hat damit nur einen Ansprechpartner, was eine erhebliche Arbeitserleichterung ist. Was dann wie zusammengefasst wird, ist abhängig von der Gesetzeslage und im jeweiligen Bundesland verschieden.
Die Antragsvorbereitung sollte auf jeden Fall eine Darstellung enthalten, was wo gemacht werden soll. Dazu gehört eine Kartendarstellung in der die beabsichtigte Lage des Projektes eingezeichnet wird sowie ein Detailplan, der aufzeigt, wo welches Bauwerk vorgesehen ist. Statt einer Karte können, je nach Behörde, auch digitale Daten eingereicht werden. In der Regel bietet die Wahrnehmung eines gemeinsamen Vororttermins erhebliche Vorteile. Es empfiehlt sich, die geplante Trasse nicht zu eng anzusetzen, um den Streckenverlauf vor Ort den notwendigen Gegebenheiten anzupassen. Oft stellt sich erst während des Bau oder Betrieb der Strecke heraus, was die optimale Linienführung ist.
Haben sich die beteiligten Institutionen geeinigt, muss ganz offiziell der Antrag auf Genehmigung gestellt werden. Je nach Umfang der geplanten Bauarbeiten kann auch professionelle Hilfe durch ein Planungsbüro erforderlich werden. Das kostet zwar Geld, aber die Fachkenntnis erleichtert die Planung und Realisierung sehr, da diese Profis genau wissen, an wen sie sich zu welchem Zweck wenden müssen. Außerdem steht in der Regel am Schluss ein Plan, dem bei der Realisierung gefolgt werden kann.
Parallel zur Zustimmung des Eigentümers des Grundstückes kann es notwendig sein, das eigentliche behördliche Genehmigungsverfahren durch Informationsgespräche vorzubereiten. Ob mit „Runden Tischen“ weitere Interessenvertretungen beteiligt werden, wie Naturschutzortsgruppen oder die Jägerschaft, ist von der jeweiligen Situation vor Ort abhängig. Oftmals können Einzelgespräche zielführender sein.
Die einzelnen Stellen werden um so mehr Bedenken äußern, in der Genehmigung entsprechende Auflagen machen oder das Vorhaben gar ablehnen, je weniger gut der eigene Antrag vorbereitet wurde. Je besser jedoch der Wunsch nach einer eigenen Strecke vorbereitet ist und auch in einem verständlichen Antrag zusammengefasst ist, desto weniger Bedenken und Auflagen wird es geben. Es kann aber auch passieren, dass eine Behörde so starke begründete Bedenken gegen den vorgeschlagenen Standort vorbringt, dass die Genehmigung gar nicht erteilt werden soll.
Weiterhin kommt eine Lösung in Form einer Strecke an anderer Stelle in Frage. Die Erfahrung zeigt aber, dass man dann am besten vorwärts kommt, wenn man sich gegenseitig ernst nimmt, d.h. auch die Argumente des Gegenübers gelten lässt. Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass für behördliche Genehmigungen eine Gebühr zu entrichten ist. Diese ist aber nicht so hoch, dass die Strecke daran scheitern könnte. Auch geben es die Verwaltungskostenbestimmungen oft her, dass dann, wenn ein Antrag mit besonders wenig Arbeit verbunden ist, die Gebühr deutlich gemindert werden kann. Je klarer und verständlicher ein Antrag ist, desto weniger Arbeit bereitet es im Grunde allen.
Behörden
Bei Projekten im Wald empfehlen wir zunächst das Gespräch mit dem zuständigen Revierleiter im örtlichen Forstamt zu suchen. Dieser kennt die zuständigen Behörden und kann euch weiterhelfen. Ist ein Genehmigungsantrag erforderlich, so wird dieser, je nach Bundesland, an die untere Forstbehörde bzw. die untere Naturschutzbehörde gestellt. Diese sind zumeist im Landratsamt des Landkreises angesiedelt und bindet dann die weiteren Behörden im sogenannten Huckepackverfahren mit ein. Der Vollständigkeit halber nachfolgend eine Auflistung von Behörden die ggf. eingebunden werden:
Gemeinde, Stadt, Planungszweckverband
- Planungsrecht
– Rahmenpläne (Regionalpläne etc., in der Regel für Biker nur bei ökologischen Konflikten problematisch)
– Bauleitpläne wie Flächennutzungsplan (dagegen darf nicht verstoßen werden) und Bebauungsplan (berechtigt dazu, so wie im Plan vorgesehen, zu bauen) - Verhandlung mit Eigentümern
Bauaufsichtsbehörde
- Baugenehmigung
– Landesbaurecht (auch Aufschüttungen und Abgrabungen können je nach Landesbaurecht baugenehmigungspflichtig sein. Falls das Vorhaben genehmigungsfrei ist, sollte man sich dies von der Bauaufsichtsbehörde bestätigen lassen.)
Naturschutzbehörde, Landschaftsbehörde, Landespflegebehörde
- Naturschutzaspekte, nicht nur im Schutzgebiet
– Prüfung Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz etc. Eingriffsregelung (wird in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild eingegriffen?)
– Artenschutz I (welche wildlebenden oder zudem besonders geschützten Arten – Rote Liste – werden ggf. gestört?)
– Artenschutz II (befindet sich das Vorhaben in einem Fauna-Flora-Habitat (FFH-Gebiet) ?, EU- Recht, Lebensraum-Verschlechterungsverbot)
– Landschaftsschutzgebiete (LSG) (Regelungen spezifisch für jedes LSG)
– Naturschutzgebiete (NSG)
Landwirtschaftsbehörde
- Erhaltung der Kulturlandschaft (schwerpunktmäßig Agrarlandschaft)
Naturparkverwaltung
- Nutzungsgestaltung in Naturparken (Besucherlenkung etc.)
Nationalparkverwaltungen
- Nutzungsgestaltung (für jeden Nationalpark spezifisch geregelt)
Biosphärenreservatsverwaltung
- Nutzungsgestaltung (für jedes Biospärenreservat verschieden)
Forstbehörde
- Bei Waldnutzung Forstamt
Wasserbehörde
- Wenn Wasserabfluß betroffen ist und sofern Strecke an Gewässern gelegen
Örtliches Ordnungsamt Einhaltung von Ordnungsrecht
- z.B. lokale Satzungen
Haftung & Sicherheit
Grundsätzlich besteht für Grundstückseigentümer in Wald und Flur eine so genannte Sicherungspflicht, d.h. der Eigentümer hat dafür Sorge zu tragen, dass öffentlich zugängliche Einrichtungen gefahrlos genutzt werden können. Im Falle eines Gestattungsvertrages kann diese Sicherungspflicht auch auf den Streckenbetreiber übertragen werden.
Im Wald und freier Natur beschränkt sich diese Sicherungspflicht auf die Beseitigung so genannter atypischer Gefahren, welche von einem umsichtigen Nutzer nicht rechtzeitig erkannt werden können (z.B. ein nicht markierter Weidedraht). Umgekehrt muss man mit typischen Gefahren, z.B. heruntergefallene Äste nach einem Sturm, jederzeit rechnen.
Für Konstruktionen und Bauwerke besteht die Verpflichtung, dass diese fachgerecht ausgeführt und gewartet werden müssen.
Der Umfang der Verkehrssicherungs- und Kontrollpflicht bestimmt sich daher nach der Einstufung der Strecke. Für Wege, auch wenn diese mit MTB-Wegweisern versehen sind, ergibt sich keine erweiterte Verkehrssicherungspflicht. Auch eigens angelegten MTB-Trails können unseres Erachtens wie Wege im Wald betrachtet werden. Bei einer Einstufung als Erholungseinrichtung, oder als Sportanlage, können hingegen erweiterte Pflichten zu sehen sein. Die DIMB arbeitet das Thema Verkehrssicherungspflicht derzeit in verschiedenen Vorträgen intensiv auf.
- DIMB Präsentation Verkehrssicherungspflicht bei MTB-Strecken, MTB-Fachgespräch in Berlin 2024
- DIMB-Verkehrssicherungspflicht bei Mountainbike-Strecken, FLL-Tagungsband Verkehrssicherheitstage 2022 (kostenpflichtig)
Weitere Informationen, (mit aber teilweise überholten Informationen zu MTB-Strecken), finden sich in den Leitfäden:
AID Verkehrssicherungspflicht für den Waldbesitzer (Punkt 2.3 und Punkt 2.5)
Forst BW Leitfaden Verkehrssicherungspflicht (Punkt 2.4 und Punkt 2.5)
Infosammlung Natursport (Punkt 4.4.2 und Punkt 4.4.3)
MTB-Beschilderung & Streckendesign
Je größer die Verletzungsgefahr und je weniger diese Gefahr für den Laien erkennbar ist, umso deutlicher und verständlicher muss der Hinweis sein. So sollte ein Drop von einem Northshore-Element deutlich mit einem Gefahrenschild zur Unterscheidung gekennzeichnet sein und immer auch ein ausgewiesener „Chickenway“ an dem gefährlichen Abschnitt vorbeiführen, so dass niemand gezwungen ist, den gefährlichen Teil zu befahren. Bei der Beschilderung gilt es, wirklich an den ungeübten Fahrer der Strecke zu denken, der anhand der Beschilderung erkennen muss, was da auf ihn zukommt. Wenn eine Strecke Varianten mit verschieden schwierigen Linien enthält, so sollte die Hauptlinie die einfachste sein. Blue Line = Main Line. Durch das Platzieren der schwierigeren Elemente an der Seite der Hauptlinie, muss der Fahrer aktiv auf diese einlenken, wenn er sie fahren möchte. Damit wird die Verantwortung sich ein schwieriges Element zuzutrauen auf den Fahrer verlagert.
Zusätzlich zur Beschilderung empfiehlt es sich bei anspruchsvollen Strecken am Anfang eine Schwierigkeit einzubauen, die für den weiteren Streckenverlauf charakteristisch ist. So wird schon zum Beginn der Strecke gezeigt, welches fahrerische Können erwartet wird und ungeübte Fahrer, oder auch Radfahrer mit gewöhnlichen Fahrrädern, werden von der Nutzung abgehalten.
An besonders gefährlichen Stellen des Streckenverlaufs kann es sogar erforderlich sein, eine Nutzung nur im Beisein eines Betreiber-Vertreters (Verein, Übungsleiter o.ä.) zu ermöglichen. Dies sind diejenigen Stellen, auf denen sich der befahrende Laie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schwere Verletzungen zuziehen wird (z.B. hohe Northshore-Drops).
Beschilderungen müssen insbesondere an folgenden Stellen gut sichtbar angebracht werden:
➧ Streckeneinstieg – Gefahrenhinweis / allgemeine Nutzungsbestimmungen (siehe Muster Anlage „Nutzungsbestimmungen“)
➧ vor Gefahrenstellen
➧ Wegekreuzungen (von oben für Biker mit Bremsschikanen / von unten Gefahrenhinweis für kreuzenden Kfz-Verkehr und Fußgänger, die in die Abfahrtsstrecke laufen könnten)
➧ Strecken-Ende (Gefahrenhinweis für Fußgänger, damit diese nicht in den Weg einsteigen)
Genaue Grenzen, wo welche Sicherungspflicht anfängt und aufhört, gibt es auch bei bester Beschilderung nicht. Hier wird immer im Einzelfall zu prüfen sein, ob der Sicherungspflichtige nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat und der Geschädigte alles ihm Zumutbare getan hat, um nicht leichtsinnig in die jeweilige Gefahr hineinzugeraten. Je besser die Beschilderung, desto geringer ist die Gefahr, im Schadensfall haftbar gemacht zu werden.
Die Beschilderung sollte sich deutlich von der Radverkehrsbeschilderung unterscheiden, da sonst die Gefahr der Verwechslung besteht und sich Radfahrer mit ungeeigneter Ausrüstung auf die Strecken verirren können. Traditionell haben sich, wie bei der Wanderwegweisung, je nach Region oder je nach Betreiber verschiedenste Beschilderungssteme entwickelt, die aber in der Praxis zumeist alle ihren Zweck erfüllen. Eine gute Orientierung über die Einstufung der technischen Wegeschwierigkeit bietet das International Trail Rating System. Dort werden umfangreiche Dokumentationen zur Bewertung und ein komplettes Beschilderungssystem kostenfrei zum Download bereit gestellt.
Streckenabnahme
In einigen uns bekannten Fällen wurde die technische Abnahme und Prüfung gefordert. Die derzeit gültigen Regelungen und Inspektionsintervalle für Sportanlagen sind die FLL Empfehlungen für Planung, Bau und Instandhaltung von Skate- und Bikeanlagen.
Diese enthalten aber kaum Ausführungen zum Bau von Strecken in der Natur, sondern beziehen sich in erster Linie auf die Sicherheit von gebauten Elementen. Als Prüfer wurden sowohl TÜV-Sachverständige, Bikeparkbau-Firmen, als auch solche Kommissäre der Radsportverbände eingesetzt, die für die Abnahme von DH-Rennstrecken verantwortlich zeichnen.
Streckenkontrolle
Neben der Beschilderung ist auch der Aspekt Streckenkontrolle wichtig. Bei beschilderten Routen wird es empfohlen zweimal im Jahr die Strecke abzufahren, wobei es hierbei in erster Linie um die Qualitätssicherung einer vollständigen Beschilderung geht. Bei Mountainbike-Sportanlagen wird eine wöchentliche Sicht-, monatliche Funktions- und jährliche Hauptkontrolle empfohlen. Bei Mountainbike-Strecken gibt es bislang keine festen Kontrollintervalle und die Intervalle werden sich daher vor allem am Gefahrenpotential und dem Zustand der baulichen Anlagen orientieren. Das Ergebnis der Streckeninspektion sollte in einem Inspektionstagebuch festgehalten werden. Neue Gefahrenstellen sind zu sichern, kenntlich zu machen oder gar vor Benutzung deutlich zu sperren und eine Reparatur des Schadens zu veranlassen.
Notfallmanagement
Trotz sorgfältigster Beschilderung und evtl. sogar Betreuung während der Abfahrt, kann durch Fahr- oder Materialfehler jemand stürzen und sich verletzen. An dieser Stelle ist es von großem Vorteil für den Verunfallten und auch den Betreiber, wenn alle Vorkehrungen getroffen wurden, um die an diesem Ort schnellstmögliche Versorgung durch den Rettungsdienst zu gewährleisten. Es empfiehlt sich, den örtlichen Rettungsdiensten den Streckenverlauf vor Eröffnung der Strecke bekannt zu geben. Sehr hilfreich sind dabei Hinweise auf in der Nähe befindliche, so genannte Rettungspunkte, die fast flächendeckend in deutschen Wäldern ausgewiesen sind. Diese Punkte sind den Rettungsdiensten in der Regel bekannt und auf speziellen Rettungswege-Karten ist eingezeichnet, wie die Rettungs-Fahrzeuge bei jeder Witterung an diesen Punkt gelangen können. Das verschafft im Falle eines Falles wertvolle Minuten für den Verletzten. Die Rettungspunkte sind online abrufbar. Aber auch das zuständige Forstamt kennt diese Punkte und kann hier weiterhelfen.
Ggf. ist es sinnvoll mit dem Rettungsdienst gemeinsam ein Rettungswegekonzept aufzustellen. Dabei wird die Strecke in verschiedene Sektoren eingeteilt und festgelegt, wie diese Sektoren vom Rettungsdienst am schnellsten erreichbar sein. Die Sektoren werden auf der Strecke ausgeschildert, so dass verunfallte Fahrer den Sektor angeben können, in welchem sie sich befinden.
Tipp!
Im Falle eines Falles müsst Ihr entweder die Nummer des vor Ort eingewiesenen Rettungsdienstes bzw. der örtlichen Leitstelle kennen. Oder Ihr wählt einfach die europaweite Notruf-Nr. 112. Die funktioniert sogar, wenn Ihr im eigenen Netz keinen Empfang haben solltet. Einfach Handy ausschalten, wieder einschalten und statt der PIN die 112 eingeben und das Handy loggt sich in das stärkste Netz ein und verbindet mit der Leitstelle.
Versicherung
Ganz wesentlich ist auch die Versicherung der Strecke bzw. des Streckenbetreibers. Ist der Betreiber eine DIMB IG, dann wird die Strecke in den Haftpflichtvertrag der DIMB e.V. mit aufgenommen. Ist der Betreiber ein Verein, kann dieser die Strecke zu einem sehr günstigen Tarif versichern. Die Bestimmungen für Vereinsversicherungen können je nach Bundesland verschieden sein. Genaueres erfahrt Ihr im Versicherungsbüro Eures Landessportbundes bzw. Landessportverbandes. Eine Übersicht der Sportbünde/-verbände ist auf der Seite des Deutschen Olympischen Sportbundes zu finden. Wird das Gelände weiterhin von der Stadt betrieben und lediglich zur Nutzung freigestellt, muss diese für eine entsprechende Versicherung sorgen. Dazu nimmt die Stadt das Risiko kostengünstig in die meist bereits bestehende erweiterte kommunale Haftpflichtversicherung auf, analog wie bei Spielplätzen und Freizeiteinrichtungen.
Weiterführende Dokumente
- Muster Nutzungshinweise für MTB-Trails
- Muster Nutzungsbedingungen für MTB-Sportanlagen
- International Trail Rating System
- Checkliste Verkehrssicherungskonzept
- FLL-Empfehlungen für Planung, Bau und Instandhaltung von Skate- und Bikeanlagen, 2016 (kostenpflichtig)
- FLL-Tagungsband Verkehrssicherungspflicht bei Mountainbike-Strecken ((kostenpflichtig)
- BDR Wettkampfbestimmungen MTB 2020
- Infosammlung Natursport
- AID Infodienst. Verkehrssicherungspflicht für Waldbesitzer
- Wald Sport Bewegt – Rechtsfragen
- Rettungspunkte online
Bauen
Wenn die organisatorischen Dinge erledigt sind und die Genehmigung vorliegt, kann endlich mit dem Bau der Strecke begonnen werden. Weiterführende Informationen zum richtigen Bauen findet Ihr den unten aufgeführten Leitfäden. Solltet ihr eine professionelle Planungs- oder Trailbaufirma für die Umsetzung benötigen, so nehmt Kontakt zu uns auf. Wir kennen Adressen von geeigneten Firmen. Vor der Beauftragung von Firmen sollten in jedem Fall Referenzen zu bisher erfolgreich umgesetzten Projekten abgefragt werden. Diese Referenzen sollten wenn möglich selbst in Augenschein genommen werden, ob die Ausführung den eigenen Vorstellungen entspricht.
Trailbau-Werkzeuge bieten die DIMB Fördermitglieder Dörte-Tools, Schneestern und SHW-FIRE unseren Mitgliedern mit Rabatten an.
Empfehlenswerte Dokumente für den Trailbau sind:
- FLL-Empfehlungen für Planung, Bau und Instandhaltung von Skate- und Bikeanlagen, 2016 (kostenpflichtig)
- IMBA EU Knowledge Hub -> Trail Building Training
- IMBA Mountain Bike Trail Development
- International Trail Rating System
- BDR Wettkampfbestimmungen MTB 2020
- Schweizer Fachpublikationen für den Bau von MTB-Anlagen
- Schweizer Fachdokumentation für Pumptracks
- Tiroler Trailbau Handbuch
- DAV Leitfaden zur Instandsetzung gemeinsam genutzter Wege
- DAV Wegehandbuch
- IMBA How to build sweet singletrack (kostenpflichtig)
- Bau und Unterhalt von Wanderwegen Schweiz
- Urteil Dirtpark in Wohngebiet zulässig
DIMB Ausbildung MTB-Streckenbau
Unser MTB-Streckenbau schult dich in den Grundlagen der Planung, Umsetzung und Betreuung von Mountainbike Strecken. Im Fokus des zweitägigen Lehrganges werden Fragen der rechtssicheren Genehmigung, der naturverträglichen und nachhaltigen Bauausführung, der eigenständigen Arbeitsorganisation, der Verkehrssicherungspflicht und den daraus folgenden Kontroll- und Aufsichtspflichten behandelt.
Die Unterrichtseinheiten finden vormittags in Theorie im Tagungsraum statt. Am Nachmittag wird am Beispiel einer Mountainbike-Strecke vor Ort gezeigt, wie das theoretisch erlernte in der Praxis umgesetzt werden kann.
FB Streckenbau Modul I Ausschreibung
Talstation Heumöderntal in Treuchtlingen
Ein weiteres Aufbaumodul ist in Planung. Weitere Infos zum MTB-Streckenbau
Die DIMB hilft
Die DIMB hat zur Unterstützung von Streckenbauern die Abteilung MTB Fachberatung, die Euch unter die Arme greift. Sendet eine Mail an fachberatung@dimb.de und fügt Eurer Anfrage die Beschreibungen und Pläne bei, damit wir Euch helfen können. Auch bietet die DIMB, über ihre örtlichen DIMB IGs, die Möglichkeit Strecken vor Ort zu betreuen. Und wir bieten Kurse zur Streckenbau Basisausbildungen an, in welchen wir die Inhalte des Streckenbauleitfadens in Theorie und Praxis ausführlich behandeln.
Die DIMB unterstützen
Die DIMB setzt sich seit über 25 Jahren für das Wohl aller Biker ein, egal ob Touren- oder Bergabfraktion und hat dabei schon so manche Gesetzesverschärfung für die Mountainbiker verhindert. Auch bei der Neuanlage von Mountainbike-Infrastruktur sind wir kompetenter Ansprechpartner. Aber auch auf der Spaßschiene sind wir mittlerweile mit Freeride-Touren & -kursen, Allmountain-Touren, Fahrtechnikevents, Stammtischen etc. in den lokalen IGs vor Ort unterwegs. Solltet Ihr der Meinung sein, dass unsere Arbeit Unterstützung verdient, dann füllt doch einfach den Mitgliedsantrag aus. Der Mitgliedsbeitrag pro Jahr ist gut investiert, denn Ihr erhaltet dafür nicht nur unsere Unterstützung, sondern Ihr könnt auch bei vielen (Internet-) Shops, Fahrtechnikschulen und Reiseveranstaltern gute DIMB Rabatte einfahren und seid teilnahmeberechtigt bei unseren Ausbildungskursen. Auch über eine Unterstützung durch eine Spende würden wir uns freuen. No DIMB, No Ride!
Referenzen
Die DIMB hilft bereits seit 2008 bei der Genehmigung von Mountainbike-Strecken. Wir können auf über 100 Projekte blicken, bei welchen wir beratend tätig waren. Einige davon sind in Betrieb der DIMB, andere im Betrieb von Vereinen oder Gemeinden, wo wir bei den Fachfragen gerne unser Wissen geteilt haben.
Checkliste
Startphase
- Wie viele Biker haben Interesse an der Strecke? (Interessenabfrage über Bikeshops (Flyer), Schulen, Vereine, Internet-Foren)
- Wie viele gehören zum „harten Kern„ und würden mithelfen?
- Sind Volljährige dabei?
- Gibt es Unterstützung durch Eltern?
- Wie viel Zeit kann investiert werden?
- Geldquellen vorhanden?
- Geldgeber, Sponsoren in Aussicht?
- Fördermittel denkbar (Gemeinde fragen)?
- Material-Unterstützung vorhanden?
- Holz, Metall etc. (Forstamt, Bauunternehmer)
- Erde (Bau-/Fuhrunternehmer)
- Ist das Projekt alleine zu schaffen? (Planungsbüro erforderlich?)
- Gründung einer DIMB IG, Beitritt zu einem Radsportverein in der Nähe oder lieber eigenen Verein gründen? (Achtung! Gründung eines eigenen Vereins erst dann, wenn absehbar, dass Chance auf eigene Strecke besteht)
Planungsphase 1
- Unterstützung suchen
- Jugendamt / Jugendzentrum
- Sportamt
- In kleineren Gemeinden Bürgermeister kontaktieren
- Unterstützung bei politischen Parteien (Gemeinderat) sichern
- Lokale Sponsoren (Bikeshops etc.)
Planungsphase 2
- Überblick verschaffen
- Naturschutz-Experten vor Ort allgemein befragen (NABU, BUND) oder Legalize-Beraterteam
- Mehrere geeignete Gelände aussuchen (Topographie, Lage, Logistik)
- Eigentümer feststellen (wenn noch nicht bekannt, Gemeindeverwaltung und / oder Kataster-/Vermessungsamt befragen)
- Eigentümer kontaktieren
- Vorurteile abbauen / Interesse wecken
- Info für Eigentümer und Verwaltung vorbereiten
- Gespräch zur Projektvorstellung ausmachen mit Eigentümer und Verwaltung (evtl. zunächst nicht alle gemeinsam)
- Imagebildende Maßnahmen durchführen (Trailcare etc.)
- Wenn nötig, Gespräche „Runder Tisch“ anregen (mit Eigentümer, betr. Interessenvertretungen wie Jäger, Naturschützer, evtl. Wanderer, Verwaltung)
- Auf evtl. Gegenargumente vorbereiten
- Vor-Ort-Termin mit allen vorschlagen
- Antrag vorbereiten und einreichen
- Lageplan in Topo 1:25.000 oder digitaler Karte
- Detailplan mit Beschreibung
- Aktive & Unterstützer während allen Planungs-Phasen immer wieder über Sachstand informieren
Bauphase
- Bei Vorliegen der Genehmigung alle Aktiven und Unterstützer informieren und aktivieren
- Biker und Eltern
- Verein
- Bauunternehmer / Fuhrunternehmer (Erdaushub)
- Forstamt (Holz, Maschinen, Helfer?)
- Städt. Bauhof (ausgediente Schilder?)
- Bau beginnen und fertig stellen (Strecke solange erkennbar sperren)
- Beschilderung konkret planen und in Auftrag geben
- Ggf. technische Abnahme durch TÜV / Rennsportkommissar
- Beschilderung und Bremsschikanen anbringen
- Ortstermin mit lokalem Rettungsdienst
- Versicherung fixieren (bei Vereinspacht)
- Vorbereitung Streckeneröffnung (Einladung, Aktive, Unterstützer, Honoratioren, Presse)
- Wenn „betreutes Abfahren“ geplant ist: Schichtpläne für Übungsleiter vorbereiten
Betriebsphase
- Regelmäßige Streckenkontrolle mit Inspektionstagebuch
- Realisierung Umbaumaßnahmen in Zusammenarbeit mit Eigentümer und Verwaltung
Downloads
- Muster Nutzungshinweise für MTB-Trails
- Muster Nutzungsbedingungen für MTB-Sportanlagen
- Checkliste Verkehrssicherungskonzept
- FLL-Empfehlungen für Planung, Bau und Instandhaltung von Skate- und Bikeanlagen, 2016 (kostenpflichtig)
- FLL-Tagungsband Verkehrssicherungspflicht bei Mountainbike-Strecken (kostenpflichtig)
- IMBA Mountain Bike Trail Development
- International Trail Rating System
- Schweizer Fachpublikationen für den Bau von MTB-Anlagen
- Schweizer Fachdokumentation für Pumptracks
- Tiroler Trailbau Handbuch
- Infosammlung Natursport
- AID Infodienst. Verkehrssicherungspflicht für Waldbesitzer
- Wald Sport Bewegt – Rechtsfragen
- MTB Handbuch BW
- BDR Wettkampfbestimmungen MTB 2021
- DAV Wegehandbuch
- Bau und Unterhalt von Wanderwegen Schweiz
- Leitfaden Natura 2000: Sport & Tourismus
- DIMB Veröffentlichungen zu Haftung und Baurecht
Glossar
Trail- und Anlagentypen
- Singletrail – Ein schmaler, meist natürlicher Pfad, oft mit Wurzeln, Steinen und technischen Passagen. Der Begriff wird nicht nur für eigens gebaute, sondern auch für bereits vorhandene Wege verwendet.
- Flowtrail – Eine leicht rollbare Strecke mit Kurven, kleinen Sprüngen und Wellen, die für ein flüssiges Fahrerlebnis sorgen.
- Freeride-Trail – Eine Strecke mit künstlichen und natürlichen Hindernissen wie Drops, Sprüngen und Northshore-Elementen (Holzbrücken).
- Enduro-Trail – Eine Mischung aus Auf- und Abfahrten, oft in Etappen gefahren.
- Downhill-Trail – Eine steile Abfahrt mit technischen Hindernissen, Sprüngen und hohen Geschwindigkeiten. Diese finden sich überwiegend in kommerziellen Bikeparks mit Liftbetrieb, da für die schweren Fahrräder eine Aufstiegshilfe benötigt wird.
- Trailpark – Wo mehrere Trails aneinander gereiht werden, entsteht ein Trailpark.
- Jumpline: Strecke mit mehreren Sprungelementen hintereinander.
- Pumptrack: Ein Pumptrack ist eine geschlossene Rundkurs-Strecke, auf der man ohne Treten fahren kann. Der Fahrer erzeugt Schwung, indem er seinen Ober- und Unterkörper pumpt.
- Dirtpark: Anlage mit verschiedenen Sprungelementen aus Erde und Holz.
- BMX Anlagen: Wellenbahn mit Hindernissen für BMX Wettkämpfe.
Trail-Elemente
-
Anliegerkurve: Erhöht gebaute Steilwandkurve, meist aus Erde.
-
Drop: Absprungkante die nicht abrollbar ist, z. B. von einem Felsen oder Holzrampe.
-
Table: Sprung mit flacher, „tischartiger“ Oberfläche in der Mitte – sicherer für Anfänger.
-
Gap: Sprung mit Lücke zwischen Absprung und Landung.
-
Roller: Kleine Wellen oder Hügel, die man rollen oder springen kann.
-
Rockgarden: Abschnitt voller Steine – technisch anspruchsvoll.
-
Root Section: Teilstück mit vielen Wurzeln – rutschig und fordernd bei Nässe.
- Northshore: Künstlich angelegte Holzbrücken/-konstruktionen über dem Boden.
- Wallride: Hohe Steilwandkurve als Holzkonstruktion.