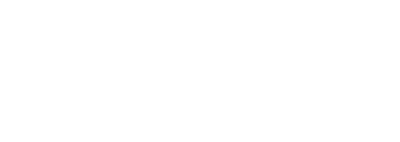Gemeinsame Wegenutzung

Gemeinsam geht es besser
Wo und wie Mountainbiker unterwegs sind
Die meisten Mountainbiker fahren Touren in ihrem direkten Wohnumfeld – umweltfreundlich, häufig direkt von der Haustür aus. Sie bevorzugen naturnahe, abwechslungsreiche Wege und stellen sich ihre Strecken individuell aus dem vorhandenen Wegenetz zusammen.
Denn die Ansprüche an Untergrund, Länge und Schwierigkeit unterscheiden sich je nach Fahrkönnen, Motivation und Tagesform. Die freie Wahl der Wege ist daher eine zentrale Voraussetzung für das Mountainbiken – vergleichbar mit dem Wandern.
Wegweisung: nicht immer sinnvoll
Die häufig diskutierte Ausschilderung separater Mountainbike-Wegenetze bringt oft hohe Kosten, aufwendige Abstimmungen und stößt mitunter auf Zweifel seitens des Naturschutzes. In vielen Regionen hat sich gezeigt: Ein gut zugängliches, gemeinsames Wegenetz ist praktikabler – und konfliktärmer.
Und wie ist das mit den Konflikten?
Die viel zitierten Konflikte zwischen Wanderern und Mountainbikern sind in der Praxis seltener als vermutet. Studien zeigen:
-
In der Bikestudie Schwarzwald 2014/2019 fühlten sich 68 % der Wandernden „gar nicht“ gestört, nur 7 % „ziemlich“ oder „sehr“.
-
Die Umfrage des Deutschen Wanderverbands (2018) ergab: 76 % erlebten „nie oder selten“ Konflikte, nur 4,4 % häufig oder sehr häufig.
Solche Konflikte entstehen – wenn überhaupt – nicht durch das Mountainbiken an sich, sondern durch Einzelfälle rücksichtslosen Verhaltens. Das gilt über alle Nutzergruppen hinweg.

Aktion „Gemeinsam Natur erleben“ im Chiemgau
Kampagne „Gemeinsam Natur erleben“ – für ein respektvolles Miteinander im Wald
Mit der Kampagne „Gemeinsam Natur erleben“ setzt sich die DIMB aktiv für gegenseitige Rücksichtnahme zwischen allen Nutzergruppen im Wald ein – also zwischen Wandernden, Mountainbikenden, Spaziergängern, Reitenden und anderen Naturnutzern.
Gemeinsam mit lokalen Partnern aus dem Tourismus wird die Kampagne bereits in Regionen wie dem Chiemgau, Sauerland, Schwarzwald und rund um Heilbronn umgesetzt. Weitere Destinationen sind in Planung.
Einheitliche Botschaft statt Einzelfallregelung
Die Schilder der Kampagne werden bevorzugt an zentralen Ausgangspunkten von Touren platziert – nicht direkt an einzelnen Wegen. So wird deutlich: Die Botschaft gilt für die gesamte Region, nicht als Sonderregelung für einzelne Trails. Ziel ist ein selbstverständliches Miteinander – überall, wo Menschen die Natur genießen.
Vorbild Graubünden: gelebte Trailtoleranz
Ein besonders gelungenes Beispiel ist Graubünden (CH). Die Region setzt konsequent auf Trailtoleranz statt Verbotspolitik – und zeigt, wie gut das Zusammenspiel unterschiedlicher Nutzergruppen funktionieren kann, wenn gegenseitiger Respekt im Mittelpunkt steht.
DIMB Trail Rules / Wegeregeln
1. Fahre nur auf Wegen.
2. Hinterlasse keine Spuren.
3. Halte dein Mountainbike unter Kontrolle.
4. Respektiere andere Naturnutzer.
5. Nimm Rücksicht auf Tiere.
6. Plane im Voraus.
Beschilderte MTB-Wegenetze – Aufwand mit begrenztem Nutzen?
In vielen Regionen besteht das Mountainbike-Angebot aus beschilderten Rundtouren, die auf bestehenden Wegen ausgewiesen werden. Diese Konzepte sind jedoch oft das Ergebnis zahlreicher Kompromisse im Abstimmungsprozess – mit dem Ergebnis, dass viele Touren nicht den Erwartungen der Zielgruppe entsprechen.
Was Mountainbiker wirklich wollen
Aktuelle Umfragen zeigen:
Nur 25 % der Mountainbikenden in Deutschland fühlen sich auf ausgeschilderten MTB-Touren wirklich wohl.
Typische Kritikpunkte:
-
Zu viele Forststraßen, zu wenig Singletrail
-
Unnötige Höhenmeter
-
Fehlende Anpassung an Fahrtechnik, Erlebniswert und Anspruch
Bereits 2009 hat die DIMB exemplarisch vier beschilderte MTB-Wegenetze in Deutschland getestet – mit ernüchterndem Fazit:
Nur im Pfälzerwald erfüllten die Touren den versprochenen Trailanteil.
DIMB-Wegenetztest Kriterien
DIMB Wegenetztest Südschwarzwald
DIMB Wegenetztest Mountainbikepark Pfälzerwald
DIMB Wegenetztest Mountainbiking Frankenwald
DIMB Wegenetztest Sauerland
Kein Alleinstellungsmerkmal mehr
Fast jede Destination bietet inzwischen ein beschildertes MTB-Netz an – ein Alleinstellungsmerkmal ist das nicht mehr. Zudem hat sich die Zielgruppe aufgrund schlechter Erfahrungen in der Vergangenheit skeptisch gegenüber beschilderten Wegenetzen gezeigt.
In Foren und Communities wird schnell transparent, wie attraktiv ein Angebot wirklich ist – oder wo es bessere Alternativen gibt.
DIMB-Empfehlung: Lieber Trails als Touren
Wir raten Tourismusakteuren:
Konzentrieren Sie sich auf die Genehmigung einzelner, attraktiver Trails. Diese lassen sich über digitale Routenempfehlungen oder GPS-Tracks flexibel zu Touren verbinden. Durch den Fokus auf die Trails reduziert sich die Zahl der Abstimmungsprozesse erheblich, da weniger Belangträger beteiligt werden müssen. Unser kostenfreier Trailbau-Leitfaden unterstützt Sie bei der Planung und Umsetzung.
MTB-Beschilderung
In der Praxis haben sich viele verschiedene MTB-Beschilderungssysteme entwickelt – oft orientiert an regionalem Design, welches damit auch zur Identität einer Region beiträgt. Mit den Beschilderungen verbunden sind jedoch hohe Kosten für Aufbau und Wartung sowie rechtliche und technische Fragen:
-
Die Unterscheidbarkeit von Rad- und MTB-Wegweisern ist essenziell – sonst besteht Verwechslungsgefahr
-
Farbwahl und Symbolik sollten auffällig gestaltet sein, um im Wald nicht übersehen zu werden
-
Wahl zwischen Knotenpunkt- oder Rundtourensystem
- Bei Überschneidung mit dem Radverkehrsnetz kann in der FGSV-Systematik eine individuelle MTB-Plakette eingesetzt werden (vgl. Baden-Württemberg, S. 47, Punkt 5.7.5)
-
Lizenzfragen bei bestehenden Systemen prüfen
Eine Orientierung wie eine MTB-Beschilderung aussehen kann, bietet das International Trail Rating System (ITRS) – mit frei zugänglichen Bewertungsdokumenten und einem Beschilderungssystem zum Download.
Digital statt starr: MTB-Tourismus modern denken
Die Beschilderung ist einer der größten Kostenfaktoren in der Umsetzung von MTB-Konzepten. Deshalb lohnt sich die Frage:
Braucht jede Bewegungsform ein eigenes Grundwegweisungssystem – oder genügt eine Basisbeschilderung, ergänzt durch digitale Tourenvorschläge und zusätzliche Trails?
Eine reduzierte Grundbeschilderung mit Online-Routenplanung, GPS-Daten und Zielgruppenfilterung bietet mehr Flexibilität, ist kostengünstiger und lässt sich leicht anpassen.
Weitere Informationen
In unserer Stellungnahme „Potenziale des naturnahen Tourismus“ finden Sie vertiefende Infos zu MTB-Konzepten und nachhaltiger Angebotsplanung.
Sie haben Fragen oder planen ein Projekt? Unsere DIMB-Fachberatung unterstützt Sie gerne!
Die Rechtslage
In Deutschland ist das Radfahren im Wald auf Straßen und Wegen gestattet. Es gilt das Gebot der Rücksichtnahme. Die Bundesländer können die Einzelheiten regeln. In Schutzgebieten können Verordnungen das Radfahren einschränken.
Zur Gesetzgebung aller Bundesländer im Einzelnen ( Mehr…)
Verkehrssicherungspflicht & Haftung
Die Verkehrssicherungspflicht wird in der Diskussion gerne angeführt, um das Mountainbiken zu reglementieren. In der Praxis finden sich aber kaum Fälle, in welchen es tatsächlich zu einer Haftung gekommen ist. Es gilt der Leitsatz der Nutzung auf eigene Gefahr:
Bundesnaturschutzgesetz:
§ 60 Haftung
Das Betreten der freien Landschaft erfolgt auf eigene Gefahr. Durch die Betretungsbefugnis werden keine zusätzlichen Sorgfalts- oder Verkehrssicherungspflichten begründet. Es besteht insbesondere keine Haftung für typische, sich aus der Natur ergebende Gefahren.
Bundeswaldgesetz:
§ 14 Betreten des Waldes
(1) Das Betreten des Waldes zum Zwecke der Erholung ist gestattet. Das Radfahren, das Fahren mit Krankenfahrstühlen und das Reiten im Walde ist nur auf Straßen und Wegen gestattet. Die Benutzung geschieht auf eigene Gefahr. Dies gilt insbesondere für waldtypische Gefahren.
Die Rechtsprechung sieht die Verantwortung beim Nutzer. Für alle Gefahren, die sich aus der Natur ergeben, gibt es grundsätzlich keine Haftung. Und wer aufgrund eines Fahrfehlers stürzt, ist selbst schuld.
Bei Gefahren die sich nicht aus der Natur ergeben, wird eine Haftung auch dann abgelehnt, wenn ein Nutzer diese hätte rechtzeitig erkennen können. Dabei wird vom Nutzer verlangt, dass er entsprechend sorgsam unterwegs ist.
Nur solche Gefahren, die walduntypisch und nicht erkennbar waren, können deshalb überhaupt zu einer Haftung führen. In diesen Fällen muss dem Grundbesitzer aber auch ein Verschulden an der Gefahr nachgewiesen werden. Unberechtigte Ansprüche wehrt die Grundeigentümer-Haftpflichtversicherung ab.
Urteil: Keine Haftung bei Baumunfall auf touristisch beschildertem Radweg.
Dass ein begrenzter Haftungsausschluß auch in § 60 Satz 2 BNatSchG konkretisiert wurde, hat das Kuratorium für Sport und Natur, dessen Mitglied die DIMB ist, durchgesetzt. Das Naturschutzrecht befasst sich ausführlich mit Sport und Erholung als Bestandteil des Naturschutzes. Natur und Sport sind keine Gegensätze. Wir haben dazu unter Veröffentlichungen eine Stellungnahme zur Stellung des Sport (Mountainbikens) im Bundesnaturschutzgesetz veröffentlich, die jeder Mountainbiker kennen sollte.
Im Rahmen der letzten Novellierungen des BNatSchG und des BWaldG hat sich der Gesetzgeber eingehend mit diesem Grundsatz befasst. Die wesentlichen Passagen aus den Gesetzesbegründungen sowie der parlamentarischen Debatte haben wir unter Anmerkungen zum Anmerkungen zum Grundsatz auf eigene Gefahr kommentiert. Mittlerweile hat sich auch der Bundesgerichtshof zu diesem Grundsatz geäußert. Unter Veröffentlichungen finden sich zusätzlich wichtige Urteile zu Haftungsfragen und Verkehrssicherungspflichten. Weitere Leitfäden und Urteile finden sich auf der Seite Wald.Sport.Bewegt.